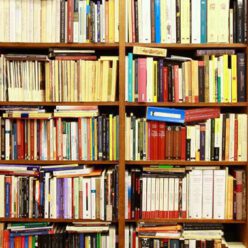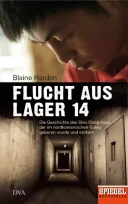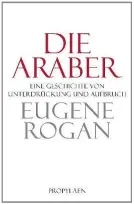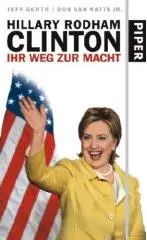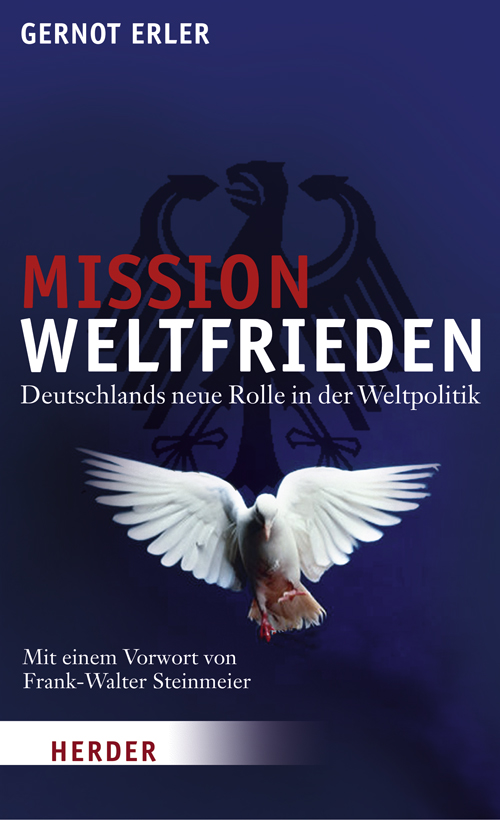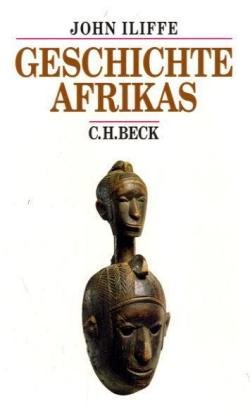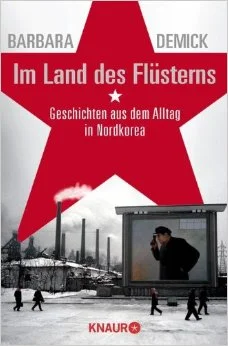
Nachdem ich im vergangenen Jahr bereits auf ein Buch über eine nordkoreanischen Flüchtling gestoßen war, fiel mir vor rund 1,5 Wochen das schon etwas ältere Werk von Barbara Demick in die Hände. Die US-amerikanische Journalistin war Korrespondentin der Los Angeles Times in Seoul und hatte aus ihren zahlreichen Interviews mit nordkoreanischen Flüchtlingen eine Zusammenstellung gemacht. Es ist kein Buch eines Akademikers, der sich aus historischer oder politologischer Sicht dem Land der Finsternis nähert, welches in den vergangenen 20 Jahren durch Atomversuche und Hungersnöte immer wieder in den Weg in die Medien gefunden hat.
Demicks Report konzentriert sich auf vier Familien ganz unterschiedlicher Herkunft aus der im Norden der kommunistischen Erbmonarchie gelegenen Stadt Ch’ŏngjin. Sie stammen aus unterschiedlichen Kasten und sind alle unterschiedlich in ihrer Treue zu den gottgleichen kommunistischen Führern Kim Il Sung und King Jong Il. Sie eint vor allem eines: der absolute Hunger und die Flucht. Alle vier Familien glauben mehr oder weniger an die Propaganda, dass Nordkorea das Paradies auf Erden ist und um sie herum in China, Südkorea oder die USA noch mehr Menschen Hunger leiden als in Nordkorea. Das höchste Gut und das Glück ist die Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Nordkoreas.
Aber es eint noch etwas über alle vier Handlungsstränge hinweg: die Protagonisten eint die Angst davor, eine der vielen Regeln zu verletzen und dafür mit dem Bannstrahl der Kommunisten belegt zu werden, in das Arbeitslager zu wandern. Wer in einer Diktatur gelebt hat, kennt dieses Gefühl der immer währenden Regeln und der beständigen Umsicht, das Regime könnte erfahren, dass man an die Parolen nicht ganz so glaubt. In Nordkorea ist dies aber alles noch ein Stück weit ausgeprägter und der Kontrollwille des Staates absolut. Ein Entweichen gibt es nicht, verschlossene Türen machen verdächtig und der inminbun, der nordkoreanische Blockwart, war allgegenwärtiger, als man dies aus anderen Regimen jemals gehört hat.
Die Geschichte des Liebespaares, welches bereits wegen den gesellschaftlichen Konventionen die Liebe nur in der stockdunklen Nacht in Spaziergängen auslebt, ist eigentlich eine Liebesgeschichte wie an jedem anderen Platz der Welt. Aber sie ist auch gekennzeichnet dadurch, dass Mir Ran, die Angebetete des Jugendlichen Jun Sang, aus einer niedrigen Kaste südkoreanischer Kriegsgefangener stammt. Ihren Schwestern ist der Zugang zur Universität verwehrt. Aber Jun Sang, der in der grossen verbotenen Stadt Pjoengjang studiert, weckt in Mi Ran den kritischen Blick. Während Jun Sang an die Beziehung recht unbekümmert heran geht, steht für Mir Ran immer die „niedrige Klasse“ ihrer Herkunft im Wege. Denn: so sehr sie ihren Holden auch liebt, seinem Glück will sie nicht im Wege stehen.

Oder Frau Song, die an nichts fester glaubt als an die Partei, auch als diese Mann und Sohn verhungern lässt. Als inminbun gehört sie zu den Treuesten der Treuesten, die tief traurig den Tod Kim Il Sungs 1993 betrauert hat. Auch der Hungertod von Mann und Sohn bringt sie nicht von der Treue zur Partei ab. Erst als sie in China, wo sie ihre bereits nach Südkorea geflohene Tochter hinlockt und sie dann nach Südkorea nachholen will, sieht, wie lange sie von ihrem geliebten Führer betrogen wurde, ändert sie ihre Meinung und geht ebenfalls nach Südkorea.
Es sind die Geschichten eines unmenschlichen Regimes, welches seine eigene Bevölkerung den Hungertod sterben lässt und gleichzeitig größenwahnsinnige Pläne einer Atombombe voran treibt. Demick hat einen Bericht vorgelegt, der zwar leicht geschrieben ist, aber schweren Tobak beinhaltet.

Demick zeigt aber auch, dass eine fortlaufende Indoktrination eine tiefgreifende Wirkung hat. Die Menschen Nordkoreas kennen nichts anderes als den grossen und geliebten Führer, die durch eine göttliche Genialität ausgezeichnet sind. Für die Probleme des Landes ist nicht deren Führung verantwortlich, sondern die USA. Sie schätzen sich glücklich, auch wenn es in der größten Not sogar den Verdacht gibt, dass seitens der staatlichen Behörden Korruption waltet.
Nordkorea zeigt einmal mehr, wie weit der menschliche Verstand in der Not faktisch ausgeschaltet wird. Wenn eine Lehrerin wie Mi Ran erzählt, dass sie im Angesicht des Hungers ihrer Schule nichts von ihrem Essen abgab, dann muss etwas nicht in Ordnung sein in dieser Gesellschaft. Und erst Recht, wenn sich für die Hungerleichen am Strassenrand niemand mehr interessiert. In der Not kennt der Mensch nur noch sich selber, insbesondere wenn diese Not über einen langen Zeitraum existiert.
Demick zeichnet ein Bild von einem Land, welches sich aus den bisherigen Berichten so gar nicht ergibt. Sie geht in die Provinz, die weit schlechter versorgt wird als das Schaufenster Pjoengjang. Gerade der Vergleich, den der Elitestudent Jun Sang, der in der Hauptstadt studierte, machte dies deutlich: während seine Freundin Mi Ran lieber einen langen Weg zu ihrer Universität in Ch’ŏngjin in Kauf nahm, da das Wohnheim nicht beheizt war und die Versorgung katastrophal, musste ihr Freund weder hungern noch frieren. Demick berichtet so aus einer Provinz, die sonst von den Zensoren bewusst geschnitten wird. Denn dann würde das sauber aufgebaute Propagandabild endgültig zusammen brechen.
Barbara Demick: Im Land des Flüsterns . Geschichten aus dem Alltag in Nordkorea
Knaur Verlag 2013